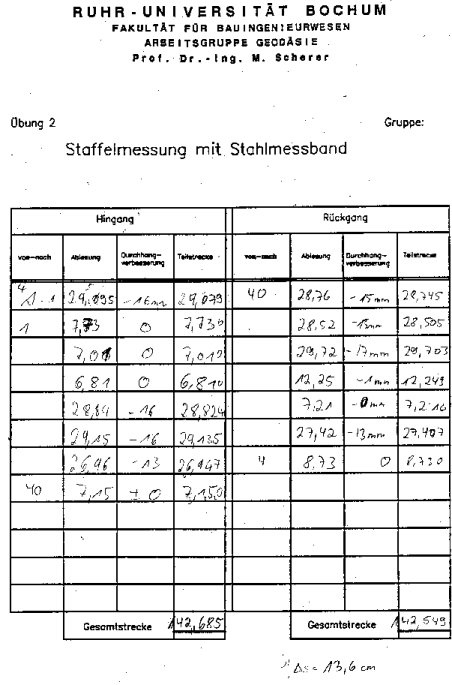
2. Sommerübung:
Längenmessung und Längsnivellement
2.1.1. Erläuterung der Aufgabe in eigenen Worten
2.1.2. Beschreibung des Meßvorganges
2.1.2.a. Stahlmessband
2.1.2.b. elektronischer Tachymeter
2.1.3. Messprotokoll
2.1.4. Auswertung der Beobachtungsdaten
2.1.4.a. Stahlmessband
2.1.4.b. elektronischer Tachymeter
2.1.5. Statistik
2.1.6. Zusammenfassung der Ergebnisse und beurteilende Stellungnahme
2.2. Längsnivellement
2.2.1. Erläuterung der Aufgabe in eigenen Worten
2.2.2. Beschreibung des Messverfahrens
2.2.3. Messprotokoll mit Verprobung
2.2.4. Auswertung der Beobachtungsdaten
2.2.5. Statistik
2.2.7. Profilschnitt
2.1. Längenmessung mit dem Stahlmeßband und dem elektronischen Tachymeter
2.1.1. Erläuterung der Aufgabe in eigenen Worten
Es ist der horizontale Abstand zwischen zwei Punkten, die im Gelände vorgegeben sind, mit einem Stahlmessband zu bestimmen. Die Entfernungsmessung mit dem Stahlmessband wird in einer Staffelmessung mit Hin – und Rückmessung durchgeführt.
Zur Kontrolle wird die Entfernung mit einem elektronischen Tachymeter in einer zweiten Entfernungsmessung gemessen. Da diese Streckenmessung in geneigter Sicht erfolgt, wird sowohl die geneigte Strecke als auch der Zenitwinkel bestimmt. Mit dem Zenitwinkel wird der Höhenunterschied berechnet. Dieser Höhenunterschied wird letztendlich mit einem Höhenunterschied verglichen ,der mit dem geometrischen Nivellement gemessen wird.
2.1.2. Beschreibung des Meßvorganges
Für die Messung mit dem Stahlmessband haben wir die Staffelmessung angewendet. Dabei misst man am besten bergab. Zuerst werden Anfangs- und Endpunkte der Meßstrecke mit Fluchtstäben abgesteckt. Mit dem Lattenrichter werden die Fluchtstäbe senkrecht aufgestellt. Gemessen wird mit einem 30m langem Stahlmessband, das auf 20°C und 50N geeicht ist. Die erste zu messende Strecke ist ca. 29m lang. Dazu wird am Ende dieser Strecke ein Fluchtstab eingefluchtet. Ein Gruppenteilnehmer stellt sich dafür ca. 3m hinter den Anfangsfluchtstab und weist seinen Kollegen, der den Fluchtstab ziemlich weit oben mit zwei Fingern kurz über der Erdoberfläche lotrecht einpendelnd hält, mit Zurufen "an, vor, ab", ein. Der nun eingefluchtete Fluchtstab wird mit dem Lattenrichter lotrecht aufgestellt. Zwei weitere Teilnehmer messen den horizontalen Abstand zwischen den ersten beiden Fluchtstäben. Dabei wird das Messband mittig an den Fluchtstäben angehalten und gespannt, wobei die 50 N Zugspannung nicht überschritten werden darf. Der fünfte Teilnehmer stellt sich seitlich in Höhe der Mitte der zu messenden Strecke auf und achtet auf die Horizontalität des Messbandes und schätzt seine Durchhängung ab. Der Durchhang wird in Form einer Tabelle angegeben, in der einer Streckenlänge der zugehörige Durchhang zugeordnet wird. Die gemessene Strecke wird protokolliert. Auf diese Weise werden weitere Teilstrecken eingefluchtet und gemessen, bis man schließlich zum Endpunkt angelangt. Die einzelnen Teilstrecken werden zu einer Gesamtlänge addiert. In einem 2. Meßvorgang , der Rückmessung , erfolgt der gleiche Vorgang vom Endpunkt bis zum Anfangspunkt. Im Protokoll wird die Ablesung des Messbandes in m festgehalten, sowie die Durchhang-Verbesserung in mm und die endgültige Länge der Teilstrecken, die sich aus Ablesung minus Durchhang-Verbesserung zusammen setzt.
Vor der Messung wird das Tachymeter maßgerecht über denn vorgegebenen Punkt zentrisch mit Hilfe des optischen Lotes aufgestellt und der Stativteller nach Augenmaß grob horizontiert. Zur Zentrierung wird das Tachymeter aufgeschraubt, dann werden die Fußschrauben solange gegeneinander gedreht, bis die Markierung des Punktes genau in der Mitte des optischen Lots erscheint. Durch Verlängerung der Stativbeine horizontiert man die Dosenlibelle grob, während über die Röhrenlibelle das Tachymeter fein horizontiert wird. Zur Feinhorizontierung wird die Röhrenlibelle parallel zu zwei Fußschrauben gestellt, mit denen die Libelle eingespielt wird. Nach Drehung um 100 gon wird die Röhrenlibelle über die dritte Fußschraube eingespielt. Zur Kontrolle werden alle 100 gon die Einspielung der Röhrenlibelle geprüft. Danach wird die Zentrierung geprüft. Kleine Ungenauigkeiten der Zentrierung können durch Verschiebung des Tachymeters auf dem Stativteller ausgeglichen werden.
Danach wird die Gerätehöhe mit einem Zollstock gemessen und zur Sicherheit vor Verstellung des Tachymeters wird die Zentrierung ein weiteres mal überprüft.
Damit sich der Vertikalkreis automatisch einstellt, wird das Objektiv des Tachymeters einmal nach oben und unten geschwenkt. Wenn das Gerät das Signal für messbereit gibt, wird der Zielpunkt anvisiert. Über dem Zielpunkt steht ein Reflektorprisma, das die Lichtwellen zum Tachymeter zurückwirft. Auch die Höhe des Reflektorprismas wird gemessen, um aus dem Höhenunterschied und der geneigt gemessenen Strecke s´ und dem Vertikalwinkel z die horizontale Entfernung berechnen zu können.
2.1.3. Messprotokoll
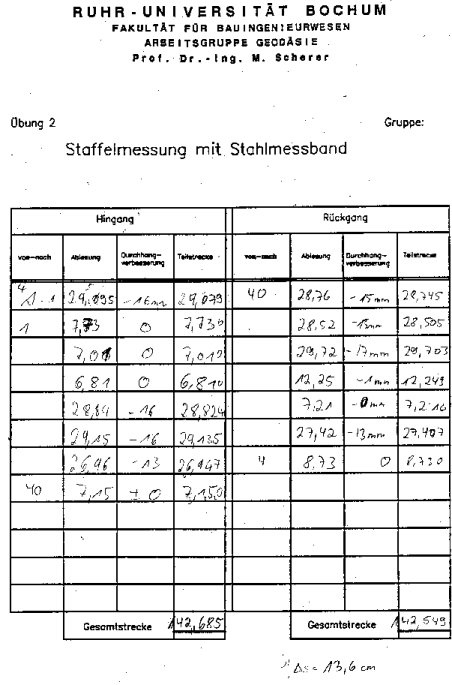
2.1.4. Auswertung der Beobachtungsdaten
a) Stahlmessband
Eine Teilstrecke errechnet sich aus der Differenz von Meßbandablesung und Durchhang-Verbesserung. Aus der Summe der Teilstrecken errechnet man die Gesamtstrecke.
b)Elektronischer Tachymeter
Über die Schrägstrecke s´ und dem Vertikalwinkel z errechnet man die Horizontalstrecke S und den Höhenunterschied
Dh:S = s´![]() 142,739
142,739![]() m
m
D
h = SD h aus dem Nivellement: - 7,269 m
D aus der Tachymeteraufnahme: - 7,298 m
Differenz: 0,29 m = 29 cm zwischen dem Nivellement und der Tachymeteraufnahme.
2.1.5. Statistik
Standardabweichung aus der Differenz zwischen Hin- und Rückmessung:
d = 142,685m- 142,549m =0,136m
d² = 0,0185m²
d
d![]() m
m
Standardabweichung des Mittels beider Beobachtungen:
d
m = ![]() m
m
Standardabweichung gegenüber der Messung mit dem elektronischen Tachymeter:
Sollwert: 142,572m
E = Sollwert – Messwert = wahrer Fehler
S1 = 142,685m E1 = -0,113m E1² = 0,0128m²
S2 = 142,549m E2 = 0,023m E2² = 0,0005m²
d
s =![]() m
m
6. Zusammenfassung der Ergebnisse und beurteilende Stellungnahme
Die Ergebnisse der Staffelmessung im Hin- und Rückgang weisen im Vergleich zur elektronischen Tachymeteraufnahme Differenzen auf. Daraus kann man schließen, dass die Fehlereinflüsse, wie z.B. ungenaues anhalten und ablesen des Messbandes, zu großer Durchhang auf Grund zu geringer Spannung des Messbandes, bei der Staffelmessung zu erheblichen Ungenauigkeiten führen können. Während die Ungenauigkeiten der Tachymetermessung kalkulierbarer sind und daher besser korrigiert werden können.
2.2. Längsnivellement
2.2.1. Erläuterung der Aufgabe in eigenen Worten
Zur Verlegung einer Wasserleitung soll die Topographie einer Trasse durch eine Längsprofilaufnahme erfasst werden. Im Abstand von ca. 10 m werden Zwischenpunkte aufgenommen. Des weiteren werden an markanten Geländestellen zusätzlich Zwischenpunkte eingerichtet, um eine möglichst genaue Aufnahme des Geländes zu gewährleisten. Der vorgegebene Höhenanschlusspunkt 100 ist als Höhenbolzen mit 100,00 m über NN angegeben. Als Richtwert für das Nivellier sollte eine maximale Reichweite von 30 m eingehalten werden. Die Höhenbestimmung des Endpunktes der Trasse wird durch ein Rücknivellement über Wechselpunkte zurück zum Höhenanschlusspunkt 100 kontrolliert. Die Differenz zwischen Hin- und Rücknivellement darf maximal 3 cm betragen.
2.2.2. Beschreibung des Messverfahrens
Nachdem die Nivellierprobe nach Näbauer durchgeführt wurde, wurde das Nivellier so aufgebaut, dass der Höhenanschlussbolzen, und der Anfangspunkt zu sehen sind. Die Höhe des Anfangspunktes wird bestimmt und im Messprotokoll festgehalten. Anschließend wird das Nivellier nach Augenmaß seitlich der aufzunehmenden Strecke so aufgestellt und horizontiert, dass der Anfangspunkt und ein beliebig neu gewählter Wechselpunkt im Abstand von ca. 30m zu sehen sind. Mit Zwischenblicken wird nun die Trasse des Kanals höhenmäßig aufgenommen. Sämtliche Zwischenpunkt auf der Trasse werden mit Hilfe eines Stahlmessbandes und durch einfluchten eines Fluchtstabes im Abstand von ca. 10 m festgelegt und markiert. Im Bereich des Geländesprungs wurde noch eine zweite Zwischenmarke mit geringerem Abstand eingefügt.
Beim Nivellieren ist darauf zu achten, dass die Abstände zwischen Nivellier und Nivellierlatte nicht größer als 30 m werden. Dies lässt sich durch die Reichenbachschen Distanzstriche schnell und einfach überprüfen. Der beliebig festgelegten Wechselpunkte wird mit einem Frosch markiert. Der Wechselpunkt dient am Anfang als Vorblick und wird nach dem Standortwechsel des Nivelliers wieder als Rückblick angenommen. Die nächsten Zwischenpunkte werden aufgenommen und ein neuer Wechselpunkt (2, 3, usw.) wird festgelegt, bis der Endpunkt der Trasse angezielt werden kann. Zur Höhenkontrolle wird nun auf dem Rückweg, nur durch Wechselpunkte, die Höhendifferenz zwischen dem Höhenanschlußpunkt 100 und dem Endpunkt kontrolliert. Das Ingenieurnivellier wird in maximaler Zielweite (30 m) zum Endpunkt aufgestellt. Dieser wird als Rückblick erfasst. Der nächste Wechselpunkt wird als Vorblick aufgenommen. Dann wird das Nivellier neu aufgestellt und es folgt ein Rückblick auf den letzten Wechselpunkt. Diese Messung wird so bis zum Höhenbolzen fortgesetzt. Die beiden Differenzen zwischen Endpunkt und Höhenbolzen sollten bei genauer Messung übereinstimmen.
Das Messprotokoll wird folgendermaßen verprobt:
![]()
![]()
2.2.3. Messprotokoll mit Verprobung
Hinnivellement:
|
Punkt |
Rückblick |
Zwischen-blick |
Vorblick |
D h+ |
D h- |
NN-Höhe |
v [mm] |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
100 |
1,096 |
100,000 |
|||||
|
A |
0,208 |
0,998 |
0,998 |
100,998 |
|||
|
10,0 |
0,722 |
0,514 |
100,484 |
||||
|
20,0 |
0,911 |
0,189 |
100,295 |
||||
|
30,0 |
1,400 |
0,489 |
99,806 |
||||
|
35,0 |
1,725 |
0,325 |
99,481 |
||||
|
40,0 |
2,694 |
0,969 |
98,512 |
||||
|
WP1 |
0,111 |
3,855 |
1,161 |
97,351 |
|||
|
50,0 |
1,468 |
1,357 |
95,994 |
||||
|
60,0 |
1,841 |
0,373 |
95,621 |
||||
|
70,0 |
2,082 |
0,241 |
95,380 |
||||
|
80,0 |
2,294 |
0,212 |
95,168 |
||||
|
WP2 |
0,728 |
2,375 |
0,081 |
95,087 |
|||
|
90,0 |
0,900 |
0,172 |
94,915 |
||||
|
100,0 |
1,100 |
0,200 |
94,715 |
||||
|
110,0 |
1,399 |
0,299 |
94,416 |
||||
|
120,0 |
1,692 |
0,293 |
94,123 |
||||
|
130,0 |
1,928 |
0,236 |
93,887 |
||||
|
140,0 |
2,183 |
0,255 |
93,632 |
||||
|
E |
2,086 |
0,097 |
93,729 |
||||
|
å R=2,143 |
å V=8,414 |
å D += 1,095 |
å D h-= 7,366 |
å R - å V = å D h+ - å D h-
2,143 - 8,414 = 1,095 – 7,366
-6,271 = -6,271
Rücknivellement:
|
Punkt |
Rückblick |
Zwischen-blick |
Vorblick |
D h+ |
D h- |
NN-Höhe |
v [mm] |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
E |
2,109 |
93,729 |
|||||
|
WP3 |
3,446 |
0,746 |
1,353 |
95,091 |
-1 |
||
|
WP4 |
3,355 |
0,232 |
3,214 |
98,305 |
|||
|
WP5 |
0,175 |
0,662 |
2,693 |
100,998 |
|||
|
100 |
1,173 |
0,998 |
100,000 |
||||
|
å V=9,085 |
å V=2,813 |
å D h+=7,260 |
å D h-=0,998 |
å R - å V = å D h+ - å D h-
9,085 – 2,813 = 7,260 – 0,998
6,272 = 6,272
Differenz zwischen Hin- und Rücknivellement:
d = å Rhin - å Vhin + å rück - å Vrück
d = 2,143 – 8,414 + 9,085 – 2,813
d = 0,001 m = 1 mm
2.2.4. Auswertung der Beobachtungsdaten
Aus der Differenz aus å Spalte 2 und å Spalte 4 erhält man den Gesamthöhenunterschied zwischen dem Anfangs- und Endpunkt. Die Höhen der einzelnen Punkte ermitteln sich aus der Addition bzw. Subtraktion der Höhenunterschiede aus den Spalten 5 und 6. Die einzelnen Höhenunterschiede ergeben sich aus den folgenden Differenzen:
Rückblick – Zwischenblick
Zwischenblick – Zwischenblick
Zwischenblick –Vorblick
Der Abschlussfehler muß streckenproportional über die Wechselpunkte der Gesamtstrecke verteilt werden. Die Höhen der einzelnen Punkte werden dann über die verbesserten Höhen der Wechselpunkte ermittelt. Da wir aber einen Abschlussfehler von nur 1mm hatten und dieser nicht mehr geteilt werden kann (10-³ m kleinste ablesbare Einheit), wird dieser Millimeter von nur einem Wechselpunkt abgezogen.
2.2.5. Statistik
Schleifenabschlußfehler: å R - å V = v
Abschlußfehler:
v = 1mm
mittlerer Kilometerfehler:
![]()
Da die Höhen des Anfangs- und Endpunktes bekannt sind (in diesem Fall sogar identisch), ist der Abschlußfehler ein wahrer Wert (Schleife von HP 100 zu HP 100)
Standortproportionale Verteilung:
1 mm / 8 Stationen = 0,125 mm je Standort
2.2.6. Zusammenfassung der Ergebnisse und beurteilende Stellungnahme
Trotz mangelnder Erfahrung mit einem Ingenieurnivellier kann die Gruppe mit dem Kilometerfehler von 1,87 mm/km durchaus zufrieden sein, da das benutzte Gerät von sich aus eine Standardabweichung von 1-3 mm/km aufweist und wir uns mit unserem Ergebnis innerhalb der erlaubten Toleranzen bewegt haben.
Um Ablesefehler zu vermeiden, haben wir jede Höhe allerdings auch immer mit drei Gruppenteilnehmern abgelesen, so dass man sich gegenseitig kontrollieren konnte. Dies wäre außerhalb einer Übung unter realistischem Messungen wohl kaum möglich.